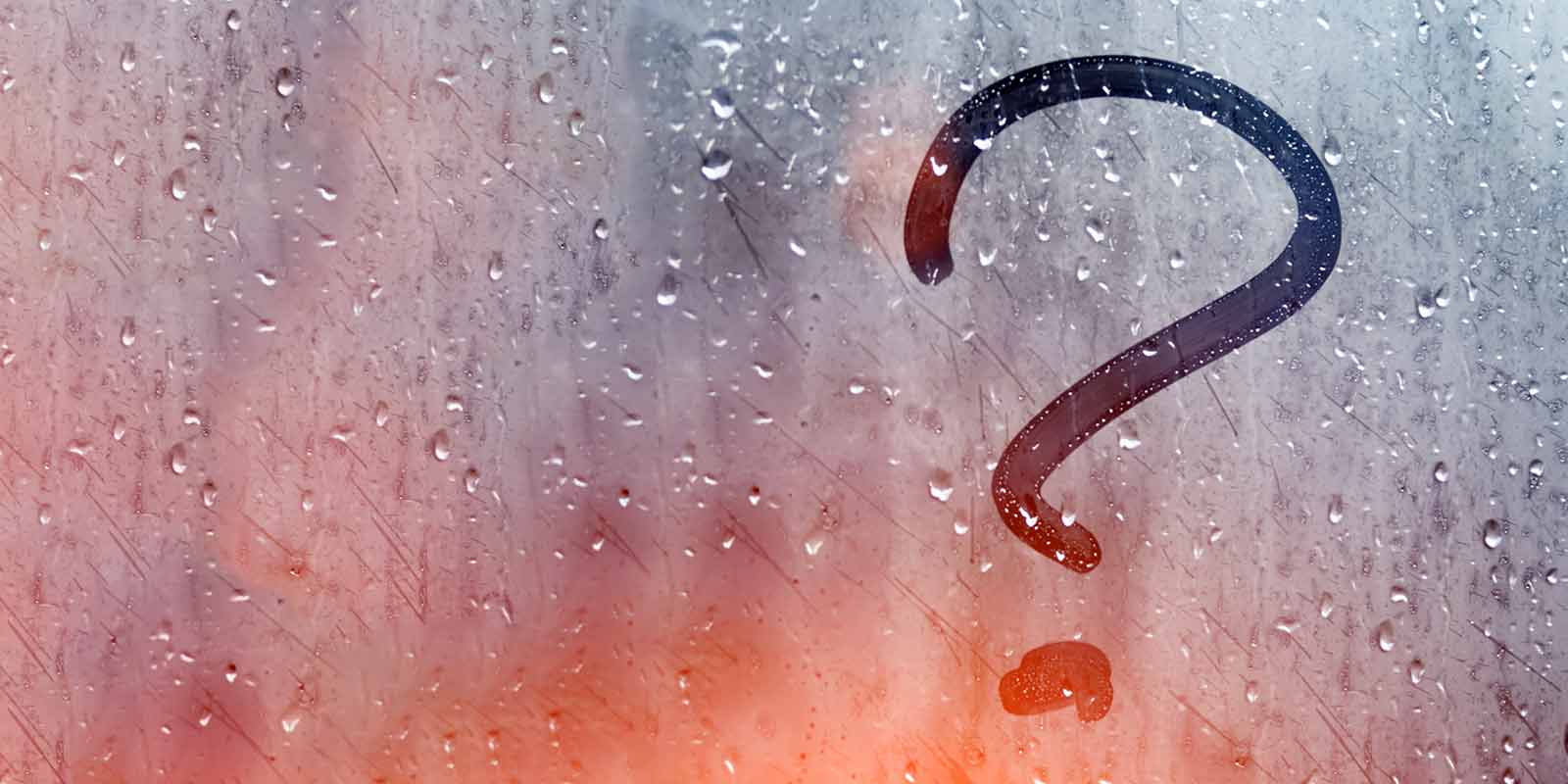
Fragen und Antworten
Sie möchten mehr über Wasser wissen? Dann finden Sie hier Antworten!
Kurze, wenn Sie es eilig haben und ausführliche, wenn Sie etwas mehr Zeit mitbringen.
Regenwasser
Was ist Niederschlagswasser?
Niederschlagswasser ist das von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser von Niederschlägen (Regenwasser sowie das Schmelzwasser von Schnee und Hagel). Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Niederschlagswasser und Regenwasser meist gleichgesetzt.
Warum beschäftigen sich die Berliner Wasserbetriebe mit dem Thema Regenwasser?
Auf Grundlage eines Beschlusses im Berliner Abgeordnetenhaus aus dem Jahr 2017 wird der Umgang mit Niederschlagswasser in Berlin neu ausgerichtet. Herausforderungen des Klimawandels wie Starkregen, Trockenzeiten und Hitzeperioden haben zu der Einsicht geführt, Regenwasser nicht mehr wie bisher schnellstmöglich von Flächen abzuleiten und wie Abwasser zu entsorgen, sondern so gut wie möglich vor Ort als Ressource zu nutzen. Wir, die Berliner Wasserbetriebe, unterstützen den Senat bei der Umsetzung der Ziele des Landes Berlin auf dem Weg zur "Schwammstadt".
Warum überprüfen die Wasserbetriebe die Versiegelungsdaten auf Privatgrundstücken?
Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) sind als abwasserbeseitigungspflichtige Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 3 Abs. 5 Nr. 2 des Berliner Betriebegesetzes (BerlBG) für die Ableitung und Reinigung des in Berlin anfallenden Abwassers verantwortlich. Dazu gehört auch die Beseitigung bzw. Bewirtschaftung von Regenwasser.
Um diesem Auftrag gerecht zu werden, benötigen die Wasserbetriebe möglichst genaue Angaben zu versiegelten Flächen, von denen Niederschlagswasser in die Kanalisation abgeleitet wird. Diese Angaben werden regelmäßig aktualisiert. Dies erfolgt u.a. mit Daten aus dem amtlichen Liegenschaftskataster, aktuellen Luftbildern und vorliegenden Kundeninformationen. Hier festgestellte Abweichungen werden geprüft und gemeinsam mit den betreffenden Grundstückeigentümer:innen korrigiert.
Wann muss Regenwasser in die Kanalisation abgeleitet werden?
Regenwasser, das nicht auf Grundstücken zurückgehalten oder in ein Gewässer abgeleitet werden kann, muss unter Einhaltung von gesetzlichen Regeln in die Kanalisation eingeleitet werden. Das ist gebührenpflichtig.
Was ist der Unterschied zwischen einer Misch- und einer Trennkanalisation?
Berlin betreibt zwei Kanalarten: die Mischkanalisation sowie die Trennkanalisation.
- Die Mischkanalisation befindet sich überwiegend innerhalb des S-Bahn-Ringes und ist 1.970 km lang. Schmutz- und Regenwasser (als Mischwasser) gelangen gemeinsam zu den Klärwerken. Die Mischkanalisation hat planmäßig eingebaute "Entlastungspunkte", über die bei stärkeren Regenfällen das mit häuslichen Abwässern vermischte Regenwasser direkt in die Gewässer gelangen kann. Dies verhindert zwar einen unkontrollierten Austritt von Mischwasser in den Straßenraum, kann aber die Gewässerqualität stark beeinträchtigen. Mit dem Bau von unterirdischen Stauräumen und dem Konzept "Schwammstadt" wird die Häufigkeit solcher "Entlastungen" schrittweise verringert.
- Die Trennkanalisation, besteht aus zweiunabhängig voneinander betriebenen Kanälen: den Schmutzwasserkanälen (Länge insgesamt 4.410 km) und den Regenkanälen (Länge insgesamt 3.370 km). Über Regenkanäle, die in Gewässern enden, darf nur Regenwasser abgeleitet werden. Über die Schmutzwasserkanäle wird nur häusliches und gewerbliches Abwasser entsprechend der gesetzlichen Vorgaben abgeleitet. Endpunkte der Schmutzwasserkanäle sind die Kläranlagen. In einer korrekt betriebenen Trennkanalisation sind unkontrollierte Überläufe von Schmutzwasser in Gewässer, anders als bei der Mischwasserkanalisation, ausgeschlossen.
Warum darf Regenwasser nicht über die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet werden? Was ist daran problematisch?
Über die Schmutzwasserkanalisation darf nur häusliches oder gewerbliches Abwasser, aber kein Regenwasser, zu den Klärwerken transportiert werden. Nur für diese Mengen sind Schmutzwasserkanäle ausgelegt. Daher kann die Einleitung von Niederschlagswasser bei Regenwetter in solche Kanäle (wir nennen das dann Fremdwasser) schnell zu einer mengenmäßigen Überlastung führen mit der Folge von unkontrolliertem Schmutzwasseraustritt in den Straßenraum, einer Überlastung der nachgeschalteten Pumpwerke bis hin zur Einschränkung der Reinigungsleistung der Klärwerke. Eine Einleitung von Niederschlagswasser in einen Schmutzkanal ist daher nicht erlaubt!
Warum benötigen wir Angaben zur Versiegelung von Grundstücken?
Berlin wächst rasant und wird dabei immer mehr versiegelt. Die Folge: die vorhandene Kanalisation ist den abfließenden Regenmengen oft nicht mehr gewachsen ist. Mit dem Konzept "Schwammstadt" will Berlin hier gegensteuern. Grundidee: möglichst viel Regenwasser mit geeigneten Entsiegelungsmaßnahmen auf Grundstücken zurückhalten. Doch wie groß ist das Entsiegelungspotenzial, insbesondere auf Privatgrundstücken eigentlich? Luftbilder geben uns einen ersten Eindruck zur Situation der Versiegelung vor Ort. Gemeinsam mit Eigentümer:innen passen wir unsere Ergebnisse an. Mit Daten wird anschließend die jährlich zu entrichtende Niederschlagswassergebühr angepasst.
Warum sollte Regenwasser möglichst auf dem eigenen Grundstück bewirtschaftet werden?
- Versickerung, Speicherung, Nutzung und Verdunstung von Regenwasser sind Prinzipien der Schwammstadt. Wer Regenwasser auf dem eigenen Grundstück bewirtschaftet, sorgt für weniger Regenwasserableitung in die Kanalisation und trägt damit dazu bei, die Zahl von unkontrollierten Überläufen in die Gewässer zu reduzieren. Das ist eine Maßnahme zum Gewässerschutz.
- Maßnahmen zur Rückhaltung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück können mit einer Minderung der Regenwassergebühr honoriert werden.
Ich möchte Regenwasser auf meinem Grundstück bewirtschaften. Wo kann ich mich beraten lassen?
Einen ersten Überblick erhalten Sie auf unserer Seite zum Thema Regenwasser. Darüber hinaus gibt es Fachunternehmen, die Sie umfassend beraten können. Empfehlungen dazu gibt es auf der Internetpräsenz der Berliner Regenwasseragentur zu finden.
Auf meinem Grundstück soll neu gebaut oder ein Teilbereich umgebaut werden - was muss ich beachten?
Grundstückseigentümer sind verpflichtet, das Regenwasser auf dem eigenen Grundstück zu bewirtschaften. Das gilt auch für Neu- oder Umbauten gleichermaßen. Für Neu- und/oder Umbau sowie baulichen Erweiterungen steht Ihnen unser Prüf- und Zustimmungsservice zur Verfügung. Die Kolleg:innen beraten Bauherr:innen, Planer:innen und Architekt:innen gern vor Beginn einer Baumaßnahme. Sie erreichen unseren Prüf- und Zustimmungsservice über das Kontaktformular unter dem Thema Regenwassereinleitung.
Ich leite Regenwasser in die Kanalisation ein, zahle aber bisher dafür keine Gebühren? Was muss ich tun?
Die Nutzung der Kanalisation ist anzeigepflichtig (§ 12 unserer Abwasserbeseitigungsatzung). Wenn Sie auf Ihrem Grundstück eine Einleitung in den Kanal feststellen, ohne dafür bisher eine entsprechende Gebühr zu entrichten, geben Sie uns Bescheid mit einer Nachricht an service@bwb.de. Wir werden den Sachverhalt prüfen und uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ich möchte Regenwasser von meinem Grundstück in ein öffentliches Gewässer einleiten (See, Fluss, Teich oder Entwässerungsgraben). An wen muss ich mich wenden?
Die Einleitung von Regenwasser in öffentliche Gewässer muss von der Wasserbehörde genehmigt werden. Hinweise zur Antragstellung sind im Hinweisblatt 1 "Einleitungen in Oberflächengewässer sowie Entnahmen aus Gewässern" der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt zusammengetragen.
Ein formloser Antrag kann per Mail an wasserbehoerde@senmvku.berlin.de gestellt werden.
Ich möchte den Überlauf meiner Zisterne an den Regenwasserkanal anschließen. Was muss ich beachten?
Wenn Ihr Grundstück bisher noch nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen ist, benötigen Sie dafür eine Genehmigung. Auf der Seite zur Regenwassereinleitung können Sie dazu bei den Berliner Wasserbetrieben eine Anfrage stellen.
Was muss ich beachten, wenn ich Niederschlagswasser auf meinem Grundstück versickern lassen möchte?
Tatsächlich soll das anfallende Niederschlagswasser gemäß § 36a des Berliner Wassergesetzes (BWG) grundsätzlich über die belebte Bodenschicht versickert werden. Dabei sind aber gewisse Randbedingungen zu beachten. Ein Parameter ist hierbei z.B. der zu erwartende Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers (z.B. Ableitung von Parkplätzen oder Metalldächern etc.). Sämtliche Informationen und Handlungsanweisungen dazu sind im Hinweisblatt 2: Versickerung von Niederschlagswasser der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt zusammengefasst:
Außerhalb von Wasserschutzgebieten ist eine wasserbehördliche Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser in der Regel nicht erforderlich. Die Bedingungen der Niederschlagswasserfreistellungsverodnung (NWFreiV) müssen erfüllt sein.
Innerhalb von Wasserschutzgebieten ist die Versickerung von Niederschlagswasser immer genehmigungspflichtig. Zuständig ist hier die Berliner Wasserbehörde. Anträge können formlos per Mail an die Berliner Wasserbehörde bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Wasserbehörde - II D 1 gerichtet werden: wasserbehoerde@senmvku.berlin.de.
Grundstücksanschluss (Abwasser)
Wie beantrage ich einen Grundstücksanschluss?
Zum Anschluss an unser Entwässerungsnetz müssen Sie vorab eine Online-Anfrage ausfüllen und diesen zusammen mit weiteren erforderlichen Unterlagen bei uns einreichen.
Nähere Informationen zu Ihrem neuen Grundstücksanschluss finden Sie hier.
Wie ist die Eigentumssituation bei Grundstücksanschlüssen geregelt?
1. Kanal vor 1995 hergestellt:
Der Kunde ist Eigentümer des gesamten Grundstücksanschlusses.
Ausnahme Ost-Berlin:
Für Grundstücksanschlüsse, die zwischen dem 23. Februar 1972 und dem 30. Juni 1991 hergestellt wurden gilt die unter Punkt 2 beschriebene Regelung.
2. Kanal nach 1995 hergestellt:
Das Kanalstück auf dem Grundstück des Kunden ist Kundeneigentum. Das Kanalstück im öffentlichen Straßenland ist Eigentum der Berliner Wasserbetriebe.
Wie kann man Rückstau vermeiden?
Für meteorologische Extreme sind die Kanäle nicht ausgelegt. Bei solchen Unwettern können sie dann mitunter nicht die gesamte Menge Abwasser ableiten und es kommt zum Rückstau. Sollten Sie im Keller Duschen, Toiletten, einen Waschmaschinenabfluss oder andere Sanitäreinrichtungen haben, dann ist der Einbau einer Abwasserhebeanlage der sicherste Schutz gegen Rückstau.
Was kann ich für den Umweltschutz und die Reinhaltung der Gewässer tun?
Zum Umweltschutz und zur Gewässerreinhaltung kann jeder beitragen. Ein großer Teil der Stoffe, die Grundwasser und Gewässer verunreinigen, kommt aus den Haushalten. Dazu einige Tipps:
-
Feste Abfälle gehören in den Müll und nicht in den Ausguss oder ins Klo. Sie verstopfen die Kanalisation und müssen mit großem Aufwand in den Klärwerken entfernt werden. Dazu gehören Speisereste, Zigarren- und Zigarettenkippen, Textilien, Präservative, Tampons, Binden, Wattestäbchen, Rasierklingen, Katzenstreu usw. Auch gebrauchtes Speiseöl gehört nicht in den Ausguss. Toilettensteine sind überflüssig.
-
Medikamente dürfen keinesfalls ins Abwasser, da selbst die modernsten Klärwerke nicht alle der enthaltenen Wirkstoffe entfernen können. Medikamentenreste können so ins Grundwasser gelangen und die Trinkwasservorräte schädigen. Nicht mehr benötigte Medikamente nehmen Apotheken kostenlos entgegen.
-
Auch Farbreste, Pinselreiniger und Lösungsmittel sowie alle anderen Chemikalien gehören nicht in die Toilette. Neben der Verunreinigung des Wassers können sie in der Kanalisation explosive Gase bilden. Alte Chemikalien nehmen die Reyclinghöfe der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) entgegen. Deren Standorte und viele Tipps zur umweltgerechten Abfallentsorgung erhalten Sie unter www.bsr.de oder telefonisch unter 030.7592.4900.
Nebeneffekte bei der Hochdruckreinigung von Kanälen
Zur Reinigung der Kanalisation setzen wir moderne Saug- und Spülfahrzeuge ein. Mit hohem Druck von bis zu 100 bar wird Wasser in eine Düse gepumpt, um die Kanalwände zu reinigen.
Bei unzureichender Be- und Entlüftung der Hausanschlussleitungen können durch den Luftdruck die Geruchsverschlüsse in Häusern ausgeblasen werden. Unangenehme Gerüche und Verschmutzungen von Erdgeschossen und Kellern sind die Folge.
Wie kann man Rattenbefall vorbeugen?
Durch die hervorragenden Klettereigenschaften und einen ausgeprägten Geruchssinn sind Ratten optimal an den Lebensraum in einer Kanalisation angepasst. Die Kanalisation ist jedoch kein Lebensraum für Ratten. Sie dient oft nur der Nahrungssuche und Fortbewegung.
Vermeiden Sie es deshalb, Ihre Speisereste über die Toilette in die Kanalisation zu entsorgen. Werfen Sie Speisereste in den Hausmüll, ggf. die Biotonne. Gleiches gilt für Straßengullys. Werfen Sie Ihren Abfall bitte in die Mülltonnen und nicht in die Natur. Ansonsten kann es schon mal sein, dass Sie ungebetenen Besuch aus dem Untergrund bekommen. Halten Sie zudem private Mülltonnen und den Hausanschlusskasten für ihre Hausanschlussleitungen dicht geschlossen.
Bitte melden Sie Rattenbefall umgehend dem Gesundheitsamt, Ihrem Verwalter oder dem Eigentümer.
Diese sind verpflichtet, sofortige Maßnahmen einzuleiten. Zusammen mit dem Berliner Gesundheitsamt und den Berliner Hausverwaltungen führen die Berliner Wasserbetriebe flächendeckende Kontrollen und Bekämpfungsmaßnahmen durch. 10 bis 20 % des Berliner Kanalnetzes werden aktiv mit Ködern bestückt und die durch Ratten verursachte Schäden an Abwasserleitungen repariert.
Warum dürfen Installation und Wartung eines privaten Wasserzählers (Sprengwasserzähler) nur durch einen im Installateurverzeichnis der Berliner Wasserbetriebe eingetragenen Fachmann durchgeführt werden?
Um das Trinkwasser und damit Ihre und unser aller Gesundheit zu schützen, ist es wichtig, dass Sie sämtliche Arbeiten der Trinkwasser-Installation Fachleuten überlassen. Dabei müssen strenge Normen − die allgemein anerkannten Regeln der Technik − beachtet werden. Das kann nur durch qualifiziertes Fachpersonal sichergestellt werden. Die Fachkenntnis der empfohlenen Installateure haben wir für Sie eingehend geprüft. Geeignete Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie in unserem Installateurverzeichnis.
Legionellenprüfung
Was sind Legionellen?
Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die vor allem in stehendem, warmem Wasser (25 °C bis 50 °C) leben und erst bei Temperaturen von über 60 °C absterben. Warmwasserspeicher und wenig durchflossene Wasserleitungen können Legionellen ideale Vermehrungsbedingungen bieten.
Worin besteht die gesundheitliche Gefährdung?
Gefährlich werden die Legionellen, wenn man sie über fein versprühtes Wasser (Aerosole) inhaliert – zum Beispiel beim Duschen bzw. bei Verwendung von Whirlpools, Inhalationsgeräten und Mundduschen, sowie insbesondere beim Einsatz von Klimaanlagen. Über den feinen Wassernebel gelangen die Bakterien in die Lungen und können dort schwerwiegende Infektionen wie das Pontiac-Fieber oder die Legionärskrankheit auslösen.
Allein in Deutschland erkranken nach Angaben einer Studie des Robert-Koch-Instituts jährlich 30.000 Menschen an Legionellen-Infektionen, in 15 Prozent der Fälle verläuft die Krankheit tödlich. Besonders betroffen sind alte, kranke und immunschwache Menschen sowie Kleinkinder.
Für wen und für welche Anlagen gelten die Änderungen?
Dem Geltungsbereich unterliegen Eigentümer und Betreiber einer Trinkwasser-Installation,
- die eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung betreiben und
- Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgeben und
- Duschen oder ähnliche Einrichtungen vorhalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt.
Was ist eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung?
Eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung:
- ist ein Warmwasserspeicher mit mehr als 400 Litern Inhalt oder
- sind Warmwasserleitungen mit mehr als drei Litern Inhalt zwischen dem Trinkwassererwärmer und der Entnahmestelle.
Ein- und Zweifamilienhäuser und dezentrale Durchlauferhitzer mit weniger als drei Litern Leitungsinhalt bis zum Wasserhahn gehören zu den Kleinanlagen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, grundsätzlich alle Anlagen überprüfen zu lassen.
Was heißt öffentliche oder gewerbliche Tätigkeit?
Unter öffentlicher Tätigkeit versteht die Trinkwasserverordnung die Abgabe von Trinkwasser an einen unbestimmten, wechselnden und nicht durch persönliche Beziehungen verbundenen Personenkreis (z.B. Kindergärten, Schulen, Justizvollzugsanstalten).
Unter gewerblicher Tätigkeit versteht die Trinkwasserverordnung, wenn das gezielte Zurverfügungstellen von Trinkwasser unmittelbar (Trinken oder Waschen) oder mittelbar (Zubereitung von Speisen) durch ein Entgelt (z.B. Miete) abgegolten wird.
Wer darf die Legionellenanalyse durchführen?
Die Untersuchung darf nur von akkreditierten und offiziell gelisteten Laboren durchgeführt werden. Die Liste dieser Berliner Labore finden Sie im Internet beim Landesamt für Gesundheit und Soziales.
Wo und wie müssen die Proben entnommen werden?
Es muss mindestens eine Probe:
- am Ausgang des Warmwasserspeichers,
- am Rücklauf des Warmwasserspeichers (Zirkulation) und
- an der vom Warmwasserspeicher am weitesten entfernten Stelle
entnommen werden.
Sind keine geeigneten Möglichkeiten zur Probenahme vorhanden, müssen diese fachgerecht angebracht werden. Die Proben sind durch akkreditierte Fachleute zu nehmen.
Wie häufig müssen die Untersuchungen durchgeführt werden?
Mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 12. Oktober 2012 wurde u.a. auch das Untersuchungsintervall verlängert. Die Untersuchungen müssen alle drei Jahre durchgeführt werden. Die neue Regelung gilt seit dem 31. Oktober 2012.
Welcher Grenzwert ist einzuhalten?
Für Legionellen wurde ein sogenannter „technischer Maßnahmenwert“ von 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 ml festgelegt. Beim Erreichen dieses Wertes ist eine Gesundheitsgefährdung zu befürchten.
Was ist zu tun, wenn der technische Maßnahmenwert nicht eingehalten wird?
Neben der Meldung an das Gesundheitsamt ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Kenntnis der Überschreitung des Maßnahmenwertes, eine Ortsbesichtigung durchzuführen oder durchführen zu lassen. Außerdem hat der Eigentümer oder Betreiber der Anlage eine Gefährdungsanalyse zu veranlassen und zu überprüfen, ob mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.
Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem Gesundheitsamt zu übersenden. Dieses prüft, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, und ordnet diese gegebenenfalls an.
Was passiert, wenn die Legionellenprüfung nicht fristgerecht bis zum 31.10.2012 oder nicht fachmännisch durchgeführt wird?
Wer als betroffener Eigentümer oder Betreiber einer Großanlage zur Trinkwassererwärmung die Untersuchung nicht richtig, vollständig oder in der vorgeschriebenen Weise durchführen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro oder in bestimmten Fällen mit Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren geahndet werden kann.
Zudem können Klagen auf Schadensersatz bzw. Schmerzensgeld seitens der Abnehmer und/oder eine Stilllegung der Wasserversorgungsanlage drohen.
Informationen über Blei
Warum ist Blei gefährlich?
Korrosion löst das Blei langsam aus Rohren oder Armaturen heraus. Es gelangt ins Trinkwasser. Übersteigt die Bleikonzentration den in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwert, kann das insbesondere für Schwangere und Kleinkinder gesundheitsgefährdend sein. Selbst niedrige Konzentrationen können, bei regelmäßiger Aufnahme, die Blutbildung und Intelligenzentwicklung bei Ungeborenen und Kleinkindern beeinflussen.
Wie kann ich mich schützen?
Sind Bleirohre vorhanden, sollten diese schnellstmöglich ersetzt werden. Bis dahin raten wir Kindern und Schwangeren, für Trink- und Nahrungszwecke möglichst abgepacktes Wasser aus dem Handel zu verwenden. Für die Körperpflege gibt es keine Einschränkungen.
Darüber hinaus empfehlen wir, Leitungswasser aus Bleirohren vor der Nutzung ablaufen zu lassen, bis es merklich kühl geworden ist. So lässt sich der Bleigehalt senken.
Woran erkenne ich alte Bleileitungen?
Einen Anhaltspunkt gibt Ihnen das Alter der Immobilie. Bis etwa 1970 wurde Blei als Installationsmaterial verarbeitet. Da Blei weich ist, können Sie freiliegende Bleileitungen gut erkennen: Sie lassen sich mit einem spitzen Gegenstand einritzen oder abschaben. Die silbergrauen Bleileitungen wurden wegen ihrer Biegsamkeit in geschwungenen Linien verlegt. Andere Leitungsmaterialien wie Kupfer oder verzinkter Stahl sind wesentlich härter und meist im rechten Winkel verlötet. Klopft man auf Blei, dann klingt es sehr dumpf.
Hinweise über die Leitungsmaterialien kann Ihnen meist auch der Hauseigentümer geben.
Wer trägt die Verantwortung für die Bleifreiheit meines Trinkwassers?
Die deutsche Trinkwasserverordnung schreibt für Blei im Trinkwasser ab dem 1. Dezember 2013 einen Grenzwert von 0,010 Milligramm pro Liter vor. Das ist nur mit einer bleifreien Versorgungsleitung zu gewährleisten. Die Verantwortung dafür trägt der Hausbesitzer. Er ist verpflichtet, seinen Mietern einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung zu stellen.
Kanalisation
Was kann ich tun, wenn es aus der Kanalisation unangenehm riecht?
Gerüche aus der Kanalisation sind nichts für feine Nasen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Im Wesentlichen liegt es daran, dass Berlin seit 20 Jahren seine Wassernutzung halbiert hat, wodurch auch in den Kanälen weniger Abwasser fließt. Durch die geringe Fließgeschwindigkeit lagert sich Schlamm schneller ab und die Fäulnisprozesse führen zu Geruchsbelästigung.
An wen kann ich mich wenden, wenn ein Kanaldeckel klappert?
Verunreinigungen, Abnutzungen oder Schäden im Aufnahmerahmen des Schachtdeckels können dazu führen, dass der Deckel nicht mehr komplett im Rahmen aufliegt und beim Überfahren durch Fahrzeuge klappert. Wenn Sie sich dadurch gestört fühlen, können Sie uns klappernde Schachtdeckel mit genauer Lagebeschreibung gern melden. Wir kümmern uns darum.
Service-Telefon: 0800.292 75 87
Wer ist für die Reinigung von Gullys zuständig?
Durch Straßenabläufe (Gullys) werden Niederschläge oder anderes Wasser, das auf die Straße gelangt, in die Kanalisation abgeleitet. Neben dem Wasser werden auch eine Menge Feststoffe wie Sand, Schmutz, Abfall und Laub in die Kanalisation gespült.
Laub und Kleinabfall sammeln sich auf und in den Straßenabläufen und behindern somit das schnelle Abfließen von Niederschlagswasser in die Regen- oder Mischwasserkanalisation der Stadt.
Für die Reinigung der Straßenabläufe (Gullys) ist die Berliner Stadtreinigung verantwortlich. Diese reinigt die "Gullys" in den Straßen der Reinigungsklasse A und B in regelmäßigen Abständen, soweit diese frei zugänglich und nicht von parkenden Autos blockiert sind. Der Auftrag an die BSR zur Reinigung der Straßenabläufe in den nachrangigen Straßen der Reinigungsklasse C erfolgt über das zuständige Tiefbauamt bzw. die Straßenverkehrsbehörde.
Wenn verunreinigte Straßenabläufe nicht gereinigt werden, kann dies, insbesondere bei Starkregenereignissen, zu Überflutungen von Straßen führen. Auch im Winter ist die BSR dafür zuständig, dass das Wasser über die Fahrbahnen in die Straßenabläufe abgeleitet werden kann.
Die Zuordnung der Straßen nach Reinigungsklassen findet man im Berliner Straßenreinigungsverzeichnis.
Bei Fragen zur Reinigung von Straßengullys wenden Sie sich bitte an die Berliner Stadtreinigung (BSR), Telefon: (030).7592-4900.
Mein Schlüssel ist in einen Gully gefallen, was mache ich jetzt?
Zunächst ist es wichtig zu wissen, ob es sich um einen Straßenablauf/Gully oder einen runden Schachtdeckel für den Kanaleinstieg handelt.
1. Gullys, so genannte Straßenabläufe, befinden sich in der Regel an Bordsteinkanten von Fahrbahnen. Hier läuft das Regenwasser entlang der Straße in die Kanalisation ab. Um grobe Gegenstände, Laub und Dreck zurückzuhalten, ist darunter ein Korb installiert. Mit etwas Glück liegt hier auch Ihr Schlüssel. In einem solchen Fall rufen Sie bitte die Berliner Stadtreinigung unter der Telefonnummer: 030.7592-4900 an.
2. Schachtdeckel sind runde, schwere, gusseiserne Kanaldeckel. Sie liegen inmitten der Straße, am Straßenrand oder im Bereich von Gehwegen. Hierüber kann unser Personal in die Kanalisation einsteigen. Sollte Ihnen ein wichtiger Gegenstand durch einen Schachtdeckel gefallen sein, rufen Sie bitte unsere kostenfreie Service-Nummer an: 0800.292 75 87. Wir klären mit der zuständigen Kanalbetriebsstelle, wie und wann wir Ihnen vor Ort helfen können.
Trinkwasseranschluss
Wie beantrage ich einen Trinkwasseranschluss?
Zum Anschluss an unser Trinkwassernetz müssen Sie vorab einen Antrag ausfüllen und diesen zusammen mit weiteren erforderlichen Unterlagen bei der für Sie zuständigen Rohrnetzbetriebsstelle einreichen.
Nähere Informationen zu Ihrem neuen Trinkwasseranschluss finden Sie hier.
Risiken durch die Nachbehandlung von Trinkwasser in der Trinkwasser-Installation
Das Umweltbundesamt hat nach Anhörung der Trinkwasserkommission des Bundesministeriums für Gesundheit Informationen zu Risiken durch die Nachbehandlung von Trinkweasser in der Trinkwasser-Installation herausgegeben, die wir Ihnen hier zum Download bereitsstellen.
Woran erkenne ich einen Defekt in der Trinkwasser-Installation?
Eine defekte Leitung in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung erkennen Sie spätestens, wenn Wasserschäden an Decke und Wänden sichtbar werden. Dann heißt es: Stellen Sie das Wasser ab und begrenzen Sie so den Schadensumfang!
Druckabfall! Ist mein Filter verstopft?
Wenn Ihre Hausinstallation dem aktuellen Stand der Technik entspricht, durchläuft das ins Haus fließende Trinkwasser hinter dem Wasserzähler einen so genannten Feinfilter. Durch ihn sollen Partikel wie Sand oder kleinste Partikelablagerungen aus den Rohrleitungen zu-rückgehalten werden. Andernfalls können sich die Partikel in der Installation ablagern und zur Korrosion führen, die Dichtungen in den Armaturen beschädigen oder das Wasser eintrüben.
Bei den Filtern gibt es grundsätzlich zwei Ausführungen: Rückspülbare und nicht rückspülbare Filter, die entweder alle 2 Monate gespült (rückspülbare Filter) oder alle 6 Monate gewechselt (nicht rückspülbare Filter) werden müssen. So ist gewährleistet, dass es nicht zum Druckabfall in der Hausinstallation kommt oder die Beschaffenheit des Trinkwassers beeinträchtigt wird.
Hinweis:
Die Reinigung der Filter kann nicht durch unseren Entstörungsdienst vorgenommen werden, da hierfür der Hauseigentümer verantwortlich ist. Daher empfehlen wir in solchen Fällen die Beauftragung eines Installateurs durch den Kunden/Hauseigentümer.
Was ist ein privater Wasserzähler/Sprengwasserzähler?
Der private Wasserzähler – auch als Sprengwasserzähler bekannt – ist ein Zähler, den Sie zusätzlich einsetzen können. Er erfasst Trinkwasser, das Sie z. B. für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen und damit nicht als Abwasser in die Kanalisation einleiten.
Ihr Vorteil: Für die Wassermenge, die Sie nachweislich im Garten verregnen, fallen keine Entwässerungskosten an.
Ein Sprengwasserzähler unterliegt der gesetzlichen Eichfrist und muss alle sechs Jahre zum Jahreswechsel ausgetauscht werden. Unser Kundenservice bietet Ihnen dazu gern weitere Informationen.
Die Installation und Wartung dieser Sprengwasserzähler darf ausschließlich von zugelassenen Installateuren durchgeführt werden, die im Installateurverzeichnis der Berliner Wasserbetriebe eingetragen sind. Der Privatwasserzähler muss zudem gesondert bei uns beantragt werden. Das Formular dazu finden Sie hier.
Wie kann ich Wasser selber fördern?
In Berlin können so genannte Eigenförderanlagen (Brunnen) errichtet werden, um sich dezentral mit Wasser zu versorgen. Das gilt allerdings nicht uneingeschränkt und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen.
In jedem Falle benötigen Sie für die Entnahme von Grund- bzw. Oberflächenwasser eine wasserbehördliche Erlaubnis. Für die Entnahme von Mengen über 150 m³ pro Jahr muss zusätzlich ein Ausnahmegrund zur Befreiung vom Anschluss- bzw. Benutzungszwang vorliegen.
Bestehende und geplante Eigenförder-, Regenwasser- und/oder Grauwassernutzungsanlagen müssen zudem dem zuständigen Gesundheitsamt und den Berliner Wasserbetrieben vor der Errichtung und Inbetriebnahme gemeldet werden.
Möchten Sie das Brunnenwasser als Trinkwasser nutzen, müssen Sie außerdem die Be-stimmungen und Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllen. Eine unmittelbare Verbindung zwischen einer Eigenförderanlage und der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist nicht erlaubt.
Trinkwasserqualität
Wie kann ich mein Wasser testen lassen?
Als Mieter oder Privatkunde können Sie das Berliner Trinkwasser untersuchen lassen. Die Wasserqualität analysieren wir in unseren registrierten Speziallaboren. Dort wird das Trinkwasser chemisch sowie mikrobiologisch unter die Lupe genommen. Ausgestattet mit modernster Analysetechnik können unsere Experten neben natürlichen Wasserinhaltsstoffen auch Schadstoffe aller Art sowie mikrobiologische Parameter nachweisen.
Ist das Berliner Trinkwasser radioaktiv belastet?
In allen Wasserwerken der Berliner Wasserbetriebe wird der Richtwert der Trinkwasserverordnung von 0,1 mSv/a deutlich unterschritten. Die im Rohwasser der Wasserwerke in geringen Konzentrationen vorhandenen radioaktiven Stoffe werden durch die bei den Berliner Wasserwerken angewandten Aufbereitungsverfahren sicher auf ein für Mensch und Umwelt verträgliches Maß reduziert.
Schon heute soll Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung eine Gesamtrichtdosis von 0,1 mSv/a (Millisievert pro Jahr) nicht überschreiten. Eine verbindliche EU-Richtlinie gibt es jedoch noch nicht. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat deshalb in den vergangenen Jahren im Auftrag des Bundesumweltministeriums bundesweit Trinkwasser auf seine Strahlung untersucht, um eine wissenschaftlich begründete und praktikable Überwachungsstrategie zur nationalen Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie zu entwickeln.
Radioaktivität ist überall, aber regional sehr unterschiedlich
Radioaktivität natürlicher Herkunft ist weltweit allgegenwärtig, wenn auch regional in sehr unterschiedlicher Verteilung. Die Unterschiede sind abhängig vom Radionuklidgehalt des Gesteins einer Region. Besonders in granitisch geprägten Gebieten, wie z. B. im Erzgebirge, Vogtland, Fichtelgebirge, Bayerischen Wald und Schwarzwald, ist mit höheren Radioaktivitätswerten zu rechnen als z.B. in Berlin.
Richtwert für Trinkwasser
Um die Strahlenexposition für den Menschen durch die Aufnahme von Trinkwasser zu begrenzen, empfahl die WHO einen Richtwert von 0,1 mSv/a einzuführen. Dieser Richtwert ist so gewählt worden, dass Wasser für den menschlichen Gebrauch ein Leben lang unbedenklich verwendet werden kann und bietet daher ein hohes Gesundheitsschutzniveau. Die EU-Trinkwasserrichtlinie setzte diese Empfehlung 1998 in Form des gesundheitsrelevanten Indikatorparameters „Gesamtrichtdosis“ um. In Deutschland ist diese Gesamtrichtdosis in der Trinkwasserverordnung von 2001 verankert und seit dem 1. Dezember 2003 verbindlich.
Braunes Wasser, was nun?
Das Trinkwasser, das wir Ihnen in einwandfreier Qualität zur Verfügung stellen, weist in seltenen Fällen eine bräunliche Färbung auf. Das ist gesundheitlich völlig unbedenklich, kann aber weiße Wäsche verfärben. Welche Ursachen es dafür gibt, lesen Sie hier.
Bauarbeiten?
Bei Arbeiten am Rohrnetz oder der Hausinstallation wird das Wasser meist abgestellt - für wenige Minuten oder mehrere Stunden. Die Folge: Wasser steht in den Leitungen, die gerade nicht benutzt werden. Werden die Leitungen wieder angeschlossen und das Wasser mit 4,5 bis 5,5 bar durchgeleitet, können sich Spuren von Rost von den Innenwänden lösen. Dieser Rost lagert sich normalerweise an den Innenseiten ab, wird aber bei Änderungen der Fließrichtung mitgerissen.
Lösung: Drehen Sie Ihre Wasserhähne voll auf und lassen Sie das Wasser ablaufen bis die Braunfärbung verschwunden ist. Das dauert zumeist nicht lange. Sollte dies keinen Erfolg haben, rufen Sie uns bitte an, wir gehen dem Problem dann auf den Grund.
Hausinstallation?
Ist in alten verzinkten Rohrleitungen die Zinkschicht „verbraucht“, kommt es zur Rostbildung, die Sie als braunes Wasser wahrnehmen. Dieser Effekt tritt außerdem auf, wenn entgegen den vorhandenen technischen Regeln ungeschützte Stahlrohre installiert wurden. In beiden Fällen sollten die Rohrleitungen durch ein in unserem Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen ausgetauscht werden.
Sind Medikamentenrückstände im Trinkwasser gefährlich?
Trinkwasser aus dem Wasserhahn hat in Deutschland höchste Güte. Es unterliegt als Grundnahrungsmittel strengsten Qualitätsvorgaben und -kontrollen, die der Gesetzgeber in der Deutschen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) regelt. Somit dürfen im Trinkwasser auch chemische Stoffe nicht in Konzentrationen enthalten sein, die unsere Gesundheit schädigen. Das Umweltbundesamt beim Bundesministerium für Gesundheit bewertet Spurenstoffe aus humantoxikologischer Sicht und erlässt entsprechende Richt- und Grenzwerte, die eine Konzentrationsobergrenze zum Schutz der menschlichen Gesundheit darstellen.
Dank moderner, empfindlicher Messmethoden können einige Arzneimittel und andere Substanzen menschlichen Ursprungs in geringen Konzentrationen in Oberflächengewässern (Flüsse und Seen) nachgewiesen werden, im Trinkwasser sind Humanarzneimittel (HAMR) jedoch bisher nicht oder nur Spuren einzelner Stoffe in Nanogramm (Milliardstel-Gramm) zu finden. Nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik bieten diese bisher im Trink-wasser nachgewiesenen Spurenstoffe nach wie vor keinerlei Anlass zu gesundheitlicher Bedenken. Im Klartext: Das Berliner Trinkwasser erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung und unterbietet viele Grenzwerte um ein Vielfaches!
Da wir unserer Verantwortung gerecht werden, auch künftige Generationen mit bestem Trinkwasser zu versorgen, forschen wir bereits seit Jahren mit wissenschaftlichen
Institutionen daran, welche Arzneimittelkonzentrationen und andere vom Menschen über das Abwasser in die Umwelt eingetragenen Stoffe nachweisbar sind. Alle erzeugten Messwerte dieser Expositions- und Wirkungsanalysen werden auf Bundesebene zusammengefasst und wissenschaftlich bewertet.
Gemeinsam mit anderen deutschen Wasserversorgern sowie Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden fordern wir darüber hinaus, dass der Eintrag von Arzneimitteln und anderen nicht natürlichen Stoffen in den Wasserkreislauf im Interesse der Nachhaltigkeit gestoppt werden muss, selbst wenn sich diese Stoffe neutral verhalten.
Zum Schutz der Gewässer kann ein jeder beitragen, indem nicht mehr benötigte Arzneimittel einer geregelten Entsorgung über die Apotheken zugeführt und keinesfalls in die Toilette geschüttet werden.
Gibt es Uran im Berliner Trinkwasser?
Das Berliner Trinkwasser ist für die Herstellung von Säuglingsnahrung geeignet. Aktuelle Messergebnisse zur Konzentration des Schwermetalls Uran belegen, dass in den Berliner Wasserwerken geltende Grenzwerte sogar um ein vielfaches unterschritten werden.
Uran ist ein nahezu überall auf der Erde weit verbreitetes, und zudem reaktionsfreudiges Schwermetall. In seinen Verbindungen kann es auf natürliche Art in Gesteinen, Mineralien sowie Wasser, Boden und Luft enthalten sein. Neben dem natürlichen Eintrag gelangt Uran auch durch menschliche Aktivitäten, z. B. durch Uranbergbau oder Verbrennung von Kohle, in die Umwelt. Während bei der Aufnahme durch den Menschen die Schädigung der Gesundheit durch radioaktive Strahlung des Urans vernachlässigbar ist, trat in den letzten Jahren seine Giftigkeit in den Vordergrund. Ähnlich wie andere Schwermetalle auch kann es insbesondere die Nierenfunktion beeinträchtigen.
Leit- und Grenzwerte für Uran
Im Jahr 2005 hat das Umweltbundesamt einen gesundheitlich lebenslang duldbaren Leitwert für Uran im Trinkwasser von 10 Mikrogramm pro Liter festgesetzt.
Mit der Novelle der Trinkwasserverordnung, gültig ab 1. November 2011, ist dieser bisherige Leitwert mit 0,010 Milligramm (= 10 Mikrogramm) pro Liter als Grenzwert für Uran festgelegt worden. Dieser Uran-Grenzwert laut Trinkwasserverordnung ist in Deutschland der weltweit schärfste und bietet gesundheitliche Sicherheit vor möglichen Schädigungen durch Uran im Trinkwasser. Für den Grenzwert ist die chemische Toxizität von Uran maßgebend.
Die Mineral- und Tafelwasserverordnung hat bisher keinen Grenzwert für Uran, obwohl viele Mineralwässer davon betroffen sind. Ein Grenzwert von 2 Mikrogramm pro Liter gilt ausschließlich für natürliche Mineralwässer und sonstige abgepackte Wässer, die der Abfüllbetrieb werblich als „geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung“ auszeichnen will. Zur Bestimmung der Urankonzentration wird das Trinkwasser am Ausgang der Berliner Wasserwerke untersucht.
Wie sinnvoll sind Wasserfilter für den Heimgebrauch?
Nitrat, Blei, Pestizide oder Bakterien? Viele Menschen misstrauen der Qualität ihres Trinkwassers und liebäugeln mit einem Wasserfilter. Berliner Trinkwasser ist jedoch von höchster Qualität und gesund. Alle in der Trinkwasserverordnung festgesetzten Grenzwerte werden weit unterschritten. Es steht vielen Mineral- und Tafelwässern aus dem Handel in nichts nach. Unabhängige Verbraucherschützer von der Stiftung Warentest bis zur Verbraucherzentrale bestätigen das immer wieder. Eine zusätzliche Behandlung von Trinkwasser ist deshalb nicht notwendig. Die kann lediglich erforderlich sein, um die Hausinstallation vor Kalk zu schützen.
Habe ich Bleirohre?
Unser Trinkwasserrohrnetz ist von jeher bleifrei. Trotzdem gibt es in Berlin noch Hausanschlussrohre und eine unbekannte Anzahl alter Gebäude mit Hausinstallationen aus Blei. Wenn Sie mehr Klarheit wünschen, dann fragen Sie doch einmal Ihren Hausbesitzer oder Verwalter nach dem Material Ihrer Rohre. Oder lassen Sie das Wasser in unserem Labor auf Blei untersuchen.
Was ist Stagnationswasser?
Bei langen Stillstandszeiten, z. B. wenn Trinkwasseranlagen selten oder längere Zeit nicht benutzt werden (Ferien- und Urlaubszeit), können sich Inhaltsstoffe aus dem Rohrleitungswerkstoff lösen oder sich Mikroorganismen (z. B. Legionellen) vermehren, sodass das Wasser beeinträchtigt wird.
Wenn aus Entnahmestellen nicht regelmäßig Trinkwasser entnommen wird (z. B. in Gästezimmern), sollten Sie mindestens alle vier Wochen einen Wasseraustausch vornehmen (besser 1x pro Woche), bis das Wasser klar und kühl ist. Nicht mehr benutzte Leitungsteile sollten Sie am Abzweig trennen lassen.
Wird die gesamte Trinkwasseranlage länger als zwei Tage gar nicht benutzt, sollte die Absperrarmatur nach der Wasserzähler-Anlage oder die Stockwerksabsperrung der Wohnung geschlossen werden. Nach Rückkehr und Öffnen der Absperrarmatur ist ebenfalls ein Wasseraustausch vorzunehmen, bis das Wasser klar und kühl ist.
Werden Gebäude darüber hinaus mehrere Monate nicht benutzt, soll die Hauptabsperreinrichtung des Grundstückes geschlossen werden (beachten Sie bitte auch unsere Hinweise zum Frostschutz). Hier empfiehlt es sich, bei Wiederinbetriebnahme einen Fachmann hinzuzuziehen, da möglicherweise ein alleiniger Wasseraustausch nicht ausreicht, um die Hygiene in der Trinkwasser-Installation zu sichern.
Die Berliner Wasserbetriebe behalten sich zum hygienischen Schutz des Trinkwassers vor, nicht mehr bzw. wenig genutzte Hausanschlussleitungen nach einem Jahr von den in Betrieb befindlichen örtlichen Verteilungsanlagen zu trennen bzw. diese zu spülen.
Welche Gefahr geht von Legionellen in der Trinkwasser-Installation aus?
Legionellen sind gefährliche Bakterien. Sie können sich in warmem Wasser gut vermehren und durch das Einatmen kleinster Wassertröpfchen (Duschen, Klimaanlagen, Dampfbäder etc.) schwere Lungenentzündungen hervorrufen. Wohnungsunternehmen, Vermieter und Verwalter sind verpflichtet, ihren Mietern einwandfreies Trinkwasser bereitzustellen. So schreibt es die Trinkwasserverordnung vor. Eigentümer und Betreiber müssen ihre Trinkwasser-Installation auf Legionellen prüfen lassen.
Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da! Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Service-Nummer:
0800.292 75 87
Kundenservice: Mo. bis Fr. 7 - 20 Uhr
Entstörungsdienst: Rund um die Uhr